Manchmal landen Themen einfach deswegen in meinem Blog, weil es für meine Gedanken zu ihnen gerade keine Lücke im Politischen Feuilleton des Deutschlandfunk-Kultur gab – und in meinem Terminkalender keine Lücke, um irgendwen anzusprechen, ob er nicht in dieser oder jener Zeitschrift einen Platz für mich freimachen will. Man richtet sich dann „im Draußen“ ein, wie „Mad Madge“ (großartig beschrieben in Siri Hustvedts Blazing World) oder die endlich als 80-Jährige mal wieder gewürdigte Alice Schwarzer oder wie Almut Sh. Bruckstein in ihrem House of Taswir (wo wir Sonntag in kleiner Runde über Hustvedts Buch sprachen, ein bisschen wild, ein bisschen geordnet und absolut stimulierend).

Tags zuvor hatte ich eine kleine Skizze zum Thema „Soziales Pflichtjahr“ geschrieben, die ich Ihnen nun hier zugänglich mache. Mein Argument läuft zu meinem eigenen Erstaunen darauf hinaus, dass ich dafür bin – wenn auch vielleicht aus einem etwas schrägen Grund: Ich glaube nämlich nicht an Sozialerziehung. Jedenfalls nicht an die, die immer so gut gemeint und oft so schlimm gemacht ist. Ich selbst habe sicher eine sehr strenge Sozialerziehung von klein auf genossen – und in den folgenden Jahrzehnten meines Lebens zuverlässig die Kreise gefunden, in denen dann immer noch eine Schippe drauf gelegt wird. Damit diese Intellektuelle da sich nur ja nicht zu viel einbildet. Die Bodenhaftung nicht verliert. Oder die Verbindung zu verwandten und unverwandten Mitmenschen.

Der Grundfehler dieser Art von Sozialerziehung und „Herzensbildung“ am Anderen ist immer derselbe: Wer sie veranstaltet, geht davon aus, dass er selbst bereits sehr viel Herzenbildung besitze (jawohl, besitze), diejenigen, an denen er dergleichen vollstrecken möchte, hingegen nicht. Klassischer kolonialistischer Irrtum, gern genommen auch in streng antikolonialistischen Kohorten. Und wer schon als Kind zu viel von solcher Sozialerziehung erlebt hat, kämpft dann ein Leben lang gegen das, was kühnere Geister den „moralischen Masochismus“ genannt haben. Darunter leidende Menschen begeben sich zwanghaft in für sie so ungünstige Situationen, dass ihnen Heilung von dieser sozial meist gebilligten Erkrankung fast unmöglich wird: denn wann immer sie sich gerade dank therapeutischer und selbsttherapeutischer Bemühungen aus den religiösen oder postreligiösen Orden zu lösen beginnen, in denen sie stets nur zur Selbstmissbilligung angehalten werden, schlägt über ihnen eine Rückholwelle der Predigt von Dienstbarkeit und Demut zusammen, unter der sie nur wieder hervorkommen können, wenn sie sehr sehr sehr sehr hartnäckig, sehr gut durchgearbeitet, sehr isolationsresistent und überhaupt hochresilient sind.

Nun gut, es gibt eben schwierige Schicksale in der Welt, kann man sagen, die Summe der Leiden bleibt gleich, und so leid es uns tut, wir brauchen nun einmal eine bestimmte Menge von Menschen, die aus Not oder höherer Einsicht oder irgendeiner Sozialfrömmigkeit heraus gewisse wenig anerkannte Dienste an der Gemeinschaft leisten etc.
Aber ist das so? Ich glaube das heute nicht mehr (falls ich es je geglaubt haben sollte). Heute glaube ich eher, dass Menschen einerseits von sich aus gern sozial gebilligte Arbeiten machen – ob als Banker, als Krankenpfleger oder als Musiklehrerin – und dass sie andererseits auch innerhalb der rein ehrenamtlich organisierten Sozialaktivitäten ihren Ehrgeiz und ihr Wettbewerbsdenken niemals ablegen. Wer gern andere unterjocht, kann das „auf Station“ ebenso gut tun wie beim Militär oder an der Universität, wer gerne freundlich zu anderen ist, desgleichen.
Was bringt, wenn man es so sieht, das soziale Pflichtjahr für alle? Das erklärt sich nun leicht: wenn es für alle gilt, verzerrt es für diejenigen die (wie ich es selbstverständlich getan habe) ein freiwilliges soziales Jahr ableisten, den Wettbewerb mit anderen, die gleich „losmachen“, nicht.

Wenn es für alle Pflicht ist, ein Jahr als Soldatin oder Altenpfleger zu dienen, dann wird die Erwartung an spezielle Gruppen vielleicht reduziert. Die sind ja immer noch deutlich. Das freiwillige Engagement in der Care-Arbeit – das erwarten wir selbstverständlich von Frauen. Und die fiesen Seiten der Sozialerziehung, die herabziehenden und kleinmachenden, die vollstrecken alle Kulturen der Welt, von denen ich weiß, regelmäßig an besonders begabten und aufstrebenden Einzelnen. Denen wird nachgesagt, dass sie kein Herz haben – nicht dem Gärtner oder dem Kfz-Mechaniker, der sich auch sozial nicht engagiert, aber eben „bescheiden“ bleibt. Ein Pflichtjahr hat den großen Vorzug, dass es alle gleichmäßig trifft, ohne auf irgendwen besonders zu zeigen. Scheinbar besonders zwanghaft, erweist es sich damit als besonders zwanglos, wenn man es mit den Zwängen vergleicht, mit diesen kleinen fiesen Mittelchen des sozialen Drucks, mit denen Menschen in die „freiwillige“ Dienstbarkeit drangsaliert werden.
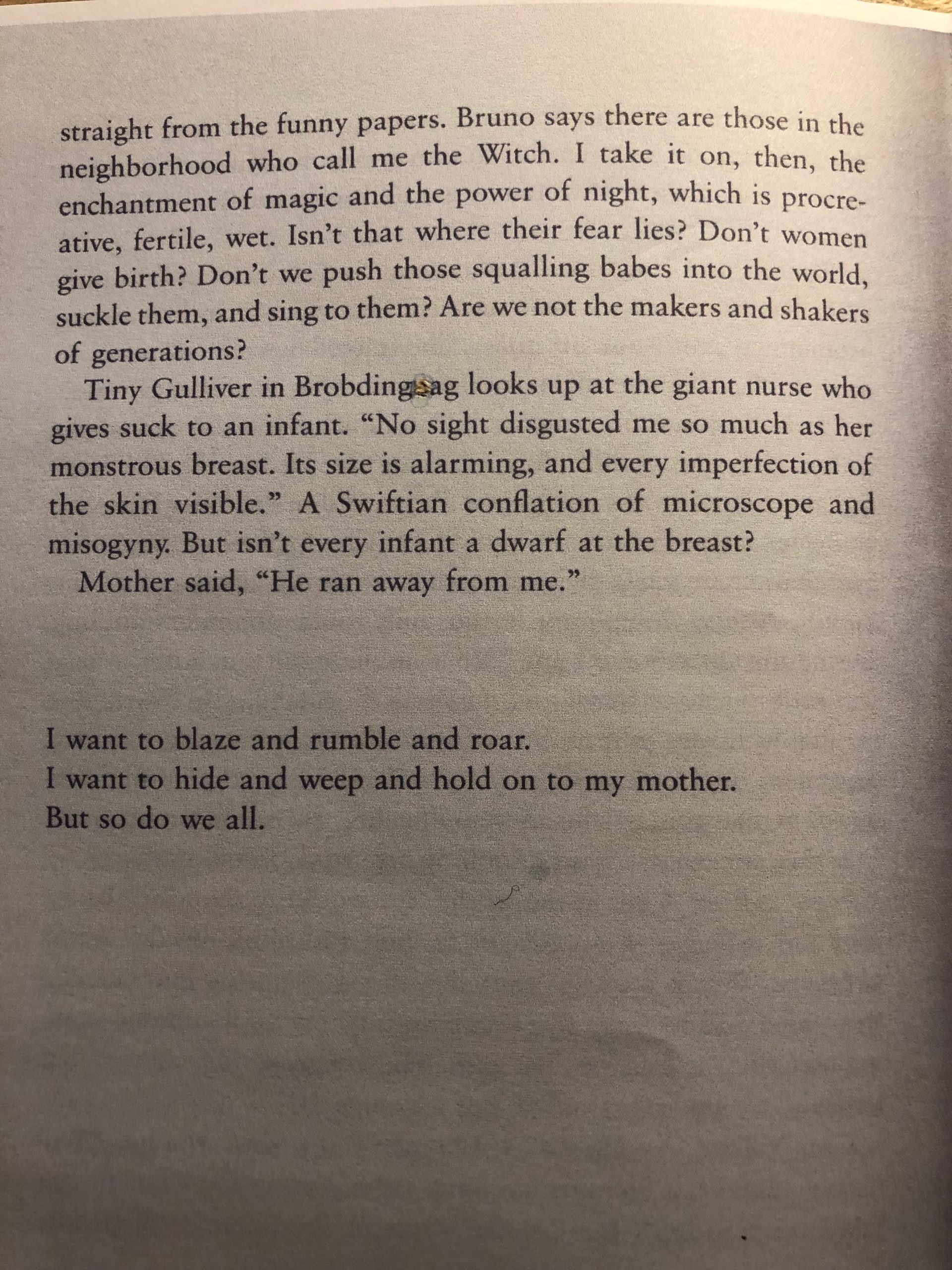
Ich habe damals, als 18-Jährige, die Arbeit im FSJ gemocht. Ich wusste schon, dass ich als schreibende Frau mein Leben lang ungeordnet zu viel arbeiten würde. Insofern habe ich ein Jahr mit 40-Stunden-Woche und schlichter Erfüllung einer nur im Anfang selbstgesetzten Pflicht als ein kleines Durchatmen vor der Studienzeit genossen. Es wäre mir später oft recht gewesen, immer darauf verweisen zu können, so wie in militärischen Kreisen die Menschen darauf verweisen, dass sie gedient haben. Aber unreguliert durch klare Begrenzungen von Forderungen, Pflichten und Angemessenheitsvorstellungen ist in vielen gesellschaftlichen Zirkeln eine unbegrenzte „Herz“- Beweispflicht gerade denen auferlegt, die eigentlich gutwillig sind, aber vielleicht einfach nur aus feinem Schamgefühl am Sozial-, Beziehungs- und Dialoggeprotze anderer nicht teilnehmen mögen oder ihre ganze Freiwilligkeit in gnadenlos unbelohnte, ihnen dennoch immens wichtig erscheinende Kulturarbeit fließen lassen.
Das soziale Pflichtjahr, so stelle ich mir vor, kann hier eine minimale Regulierung einführen, die nicht nur Typen wie mir eine gewisse Entlastung von monströsen Ansprüchen der sozialen Welten verschaffen würde.
